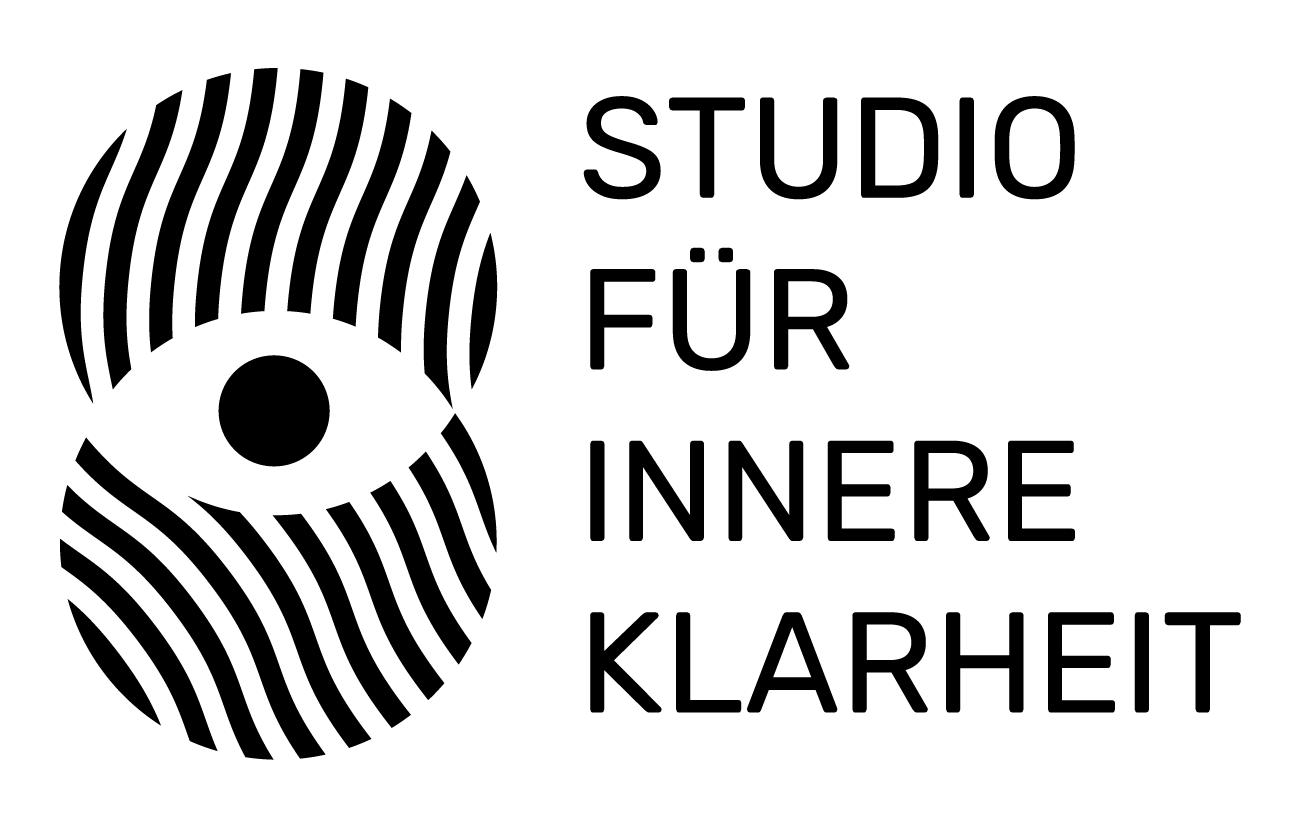Wie funktioniert eigentlich persönliche Veränderung?
Viele wünschen sich Veränderung – in ihrem Verhalten, ihren Gefühlen, ihren Beziehungen. Und viele glauben: Wenn ich es nur verstehe, dann kann ich es ändern.
Doch unser Gehirn funktioniert anders.
Veränderung geschieht nicht allein durch Einsicht. Sie geschieht durch neue Erfahrung, die emotional relevant ist – und die Sicherheit gibt.
Unser Gehirn ist der Ausgangspunkt für unsere Gedanken und Emotionen. Es entwickelt sich im Laufe unseres gesamten Lebens mit uns zusammen weiter und bildet ganz individuelle Strukturen aus. Es ist wahrscheinlich nicht überraschend, dass es so individuell ist wie unser Fingerabdruck.
Und es bewertet die Erfahrungen, die wir machen, in Bezug auf die grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben.
So bilden sich Denk- und Verhaltensmuster heraus, die darauf ausgerichtet sind, unsere Bedürfnisse zu erfüllen bzw. zu schützen.
Diese Muster sind wichtig und hilfreich, um uns durch unser Leben zu steuern. Aber manchmal verändern sich die Rahmenbedingungen. Oder die Muster, die wir gebildet haben, sind mehr darauf ausgerichtet uns zu beschützen, als aus uns heraus zu kommen. Dann kann es sein, dass unsere Muster uns eher einschränken und nicht mehr dabei helfen unsere Bedürfnisse zu erfüllen – und das macht unzufrieden.
Wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, dann selten, weil wir voll und ganz damit zufrieden sind. Meistens liegt es daran, dass wir irgendwie unglücklich sind, aber nicht genau wissen, warum.
Das Schwierige: Diese Muster laufen unbewusst ab. Sie sind Teil unserer Identität – sie sind selbstverständlich für uns und werden selten bewusst von uns wahrgenommen.
Aber wie geht das jetzt mit der Veränderung?
Diese Muster zu erkennen und zu verstehen, ist dann häufig der erste Ansatz. Aber das reicht (noch) nicht. Um sie wirklich zu verändern, geht es darum, in seinem echten Leben andere Erfahrungen zu machen. Anders abzubiegen. Und zwar häufig genug, damit das Gehirn lernen kann: aha, das ist ja gar nicht so, wie ich es unbewusst angenommen habe! Dabei laufen viele Prozesse im Unterbewusstsein ab, d.h. wir bemerken sie gar nicht. Wir bemerken nur irgendwann die Resultate davon.
Wie helfen Coaching oder Therapie bei so etwas?
Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche hilfreiche Methoden, wie das funktionieren kann. Und das Verstehen der ursprünglichen Muster muss nicht zwangsläufig am Anfang davon stehen. Lösungsorientierte Verfahren zum Beispiel zielen darauf ab, genau das zu fördern, was die Veränderung bringt: neue Erfahrungen, in denen etwas anders läuft als bisher, und damit einhergehend nach und nach Lerneffekte im Unterbewusstsein.
Wenn wir uns mehr darauf konzentrieren, wie es anders sein soll, anstatt was das Problem ist, können erstaunliche Dinge passieren.
In Studien zu der Effektivität wurden Lösungsorientierte Verfahren bereits vielfach als wirksam validiert. (Zum Beispiel in der hier: Link)
Manchmal kann das wirksamste auch sein, einfach etwas zu spüren. Wenn Emotionen da sein dürfen und wir uns dabei sicher fühlen, verarbeitet unser Körper sie auf seine eigene Weise. Das sind oft kraftvolle Momente – und sie zeigen: Unser Unterbewusstsein lernt, wenn es sich sicher fühlt und wenn es alte Reaktionen neu verarbeiten kann. Sogar ganz ohne Worte.
Ein Coaching/Therapie Setting hilft hier auf zwei Wegen: Es bietet diesen sicheren Raum, in dem genau das sein darf. Dieser Raum ist einzigartig. Da keine Beziehung im Alltag frei von Erwartungen oder Meinungen ist, fällt es dort häufig schwerer, einen völlig sicheren Raum herzustellen. Schon allein unser eigenes Interesse daran, dass unser Gegenüber nichts schlechtes von uns denken soll, kann schnell den Weg verstellen. Darüber hinaus besteht dazu die Beziehung zu einer ubeteiligten Person, die geschult ist, richtig auf Emotionen einzugehen. Dadurch entsteht Co-Regulation und wirkungsvolle Zusammenarbeit.
Fest steht: Jeder Mensch ist sehr individuell. Und deswegen hilft nicht für alle von uns die gleiche Methode gleich viel. Eine wirklich gute psychologische Begleitung, ob es jetzt Coaching oder Therapie ist, geht darauf ein. Indem sie auf die Person eingeht, ihre Situation nachvollzieht und einen ausreichend großen Werkzeugkoffer mit Herangehensweisen zur Verfügung hat, um ihr etwas Passendes anzubieten.
Quelle:
Dies ist eine persönliche Zusammenfassung einiger Erkenntnisse aus dem Buch “Neuropsychotherapie” von Klaus Grawe. Klaus Grawe war ein Psychotherapieforscher, der empirisch untersuchte, welche Faktoren Therapie wirksam machen. Er interessierte sich dabei auch sehr für neurologische Forschung und deren Erkenntnisse. In dem Buch schlägt er eine spannende Brücke zwischen Neurologie und Psychotherapie. Ich finde das spannend, weil seine Ansätze die Qualität der eigenen Arbeit als Coach oder Therapeutin verbessern können, unabhängig welcher Ausrichtung man angehört